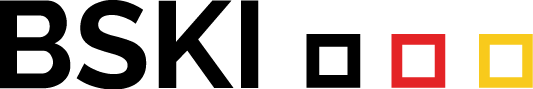Bislang liegt keine belastbare Erklärung für den flächendeckenden Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel vor. Der Ausfall erstreckte sich über große Teile Spaniens, Teile Portugals sowie Südfrankreich und dauerte stellenweise bis zu 24 Stunden. Mit rund 60 Millionen betroffenen Menschen und etwa 25.000 Rettungsdiensteinsätzen pro Tag sind die direkten Folgen bislang nur eingeschränkt messbar, die wirtschaftlichen Schäden dürften sich im Milliardenbereich bewegen.
Der ad-hoc Verlust von rund 15 Gigawatt im spanischen Stromnetz stellte die Energieversorgung in gesamt Europa auf die Probe. Die Netzsteuerung in Europa gilt als hochautomatisiert, KI-gestützt und auf Schwankungen von bis zu 3 Gigawatt stabil ausgelegt.
Um ähnlichen und unter Umständen noch weiter reichenden Vorfällen entgegenzuwirken, bietet sich heute die Möglichkeit, aus den jüngsten Vorfällen zu lernen. Warum konnten Steuerungssysteme und Netzleittechniker nicht gegensteuern, wie kann ein nahezu gleichzeitiger Ausfall von Photovoltaik-Leistung dieser Größenordnung erfolgen – und wie lassen sich diese Probleme zukünftig vermeiden? Auch die Frage nach der Rolle menschlicher Versäumnisse muss gestellt werden.
Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, äußerte sich zuletzt beschwichtigend. Aber ein vergleichbarer Fall in Deutschland – mit 84 Millionen Einwohnern und wesentlich größerer wirtschaftlicher Dichte – hätte ungleich schwerere Auswirkungen. Der Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI e. V.) sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf. Eine unabhängige, faktenbasierte Untersuchung ist unerlässlich.
Der BSKI fordert deshalb ein stringentes, europäisch abgestimmtes Energiesicherheitsmonitoring. Dieses muss auch ausländische Schadenslagen systematisch auf nationale Risiken übertragen. Nur so lassen sich präventive Schutzmaßnahmen objektiv ableiten und die Systemresilienz der Energieversorgung in der Bundesrepublik sicherstellen.